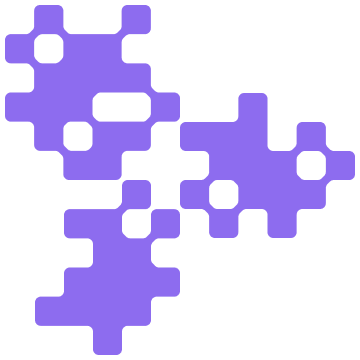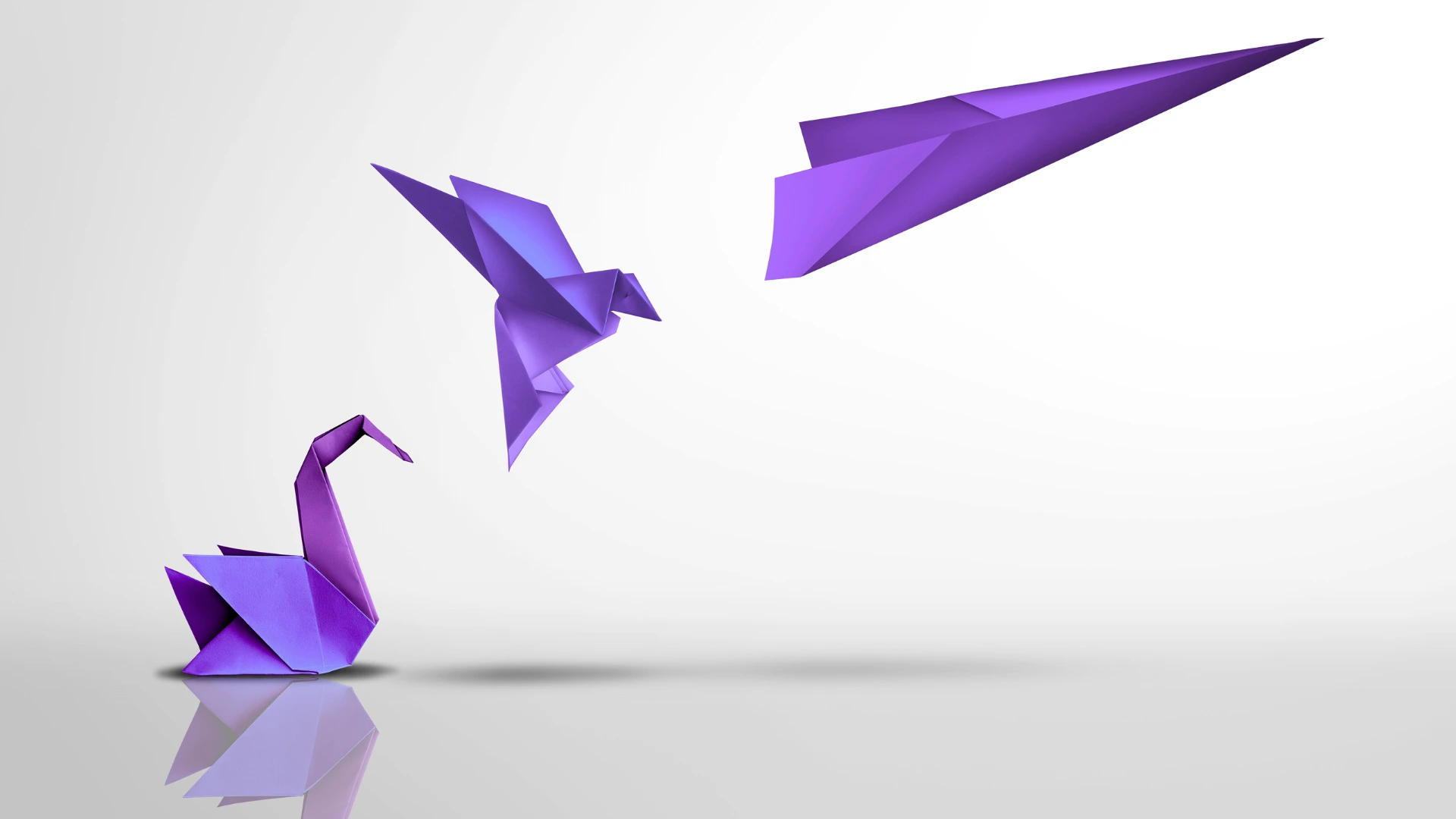
Von Sprache zur Moderne – Eine Zeitreise des Wissens
Hanna Lorenzer
Wed Apr 23 2025
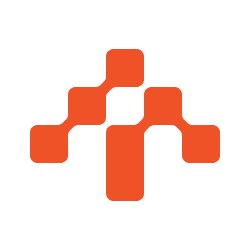
Inhaltsverzeichnis
- Was ist eigentlich Wissen? – Vom Datensatz zur Bedeutung
- Der Anfang: Wenn Wissen noch gesprochen wird
- Der Übergang zur Schrift: Wissen wird dauerhaft
- Der Buchdruck: Wissen beginnt zu zirkulieren
- Speicherorte des Wissens – Und was sie über uns verraten**
- Die Moderne: Wissen wird System
- Die digitale Wende: Wissen wird verfügbar
- Der Sprung in die Gegenwart: KI als Wissensform?
- Und was bleibt?
Wissen war nie einfach nur da. Es ist entstanden – in Begegnungen, in Medien, in Machtverhältnissen. Es hat sich gewandelt – mit jeder neuen Kulturform, mit jeder neuen Technik. Und es hat uns gewandelt – als Gesellschaften, als Gemeinschaften, als Einzelne. Dieser Blog ist kein Lexikoneintrag, sondern ein Rundgang durch die Geschichte des Wissens. Wir bewegen uns entlang von Ideen, nicht nur entlang von Jahreszahlen. Es geht darum zu verstehen, wie sich unser Verhältnis zu Wissen verändert hat – und warum das gerade heute so wichtig ist.
Was ist eigentlich Wissen? – Vom Datensatz zur Bedeutung
In einer Welt, in der Informationen jederzeit verfügbar sind, wird es umso wichtiger, zu verstehen, was Wissen eigentlich ist – und was es eben nicht ist. Denn zwischen rohen Daten und tiefer Erkenntnis liegt ein weiter Weg.
Ein hilfreiches Denkmodell ist die sogenannte DIKW-Pyramide:
Diese Stufen bauen aufeinander auf, sind aber nicht automatisch miteinander verbunden. Zwischen Daten und Weisheit liegt ein weiter Weg – geprägt von Kontext, Interpretation und Urteilskraft. Gerade im digitalen Zeitalter – und besonders im Umgang mit künstlicher Intelligenz – ist diese Unterscheidung zentral. Sprachmodelle verarbeiten Informationen, erkennen Muster, formulieren plausible Texte. Doch was ihnen fehlt, ist das, was Wissen ausmacht: Absicht, Bedeutung, Reflexion. Das Modell macht deutlich: Wissen ist nicht einfach da. Es entsteht – durch den Menschen, durch Zeit, durch Haltung.
Der Anfang: Wenn Wissen noch gesprochen wird
Alles beginnt mit der Sprache. Lange bevor etwas aufgeschrieben wurde, war Wissen ein Klang. Worte, die über Lippen wanderten, weitergegeben in Geschichten, Liedern, Ritualen. Sprache war nicht nur Kommunikation, sie war Gedächtnis. Und dieses Gedächtnis lebte – solange jemand es aussprach. Das Wissen der frühen Menschheit war flüchtig, aber gemeinschaftlich. Es gehörte niemandem, aber es brauchte jemanden. Jemanden, der erinnert. Jemanden, der erzählt. Doch Sprache hat eine Grenze: Sie verschwindet, sobald sie gesagt wurde. Sie braucht Nähe, Zeit, Wiederholung. Und genau hier entstand – über Jahrtausende hinweg – ein menschliches Bedürfnis: Wissen sollte nicht mehr nur gehört, sondern bewahrt werden.
Der Übergang zur Schrift: Wissen wird dauerhaft
Die Schrift war mehr als ein technischer Fortschritt. Sie war ein radikaler Wechsel im Umgang mit Wissen. Zum ersten Mal wurde es möglich, Informationen unabhängig vom Gedächtnis zu speichern. Was zuvor flüchtig war, konnte nun bleiben. Worte wurden Zeichen. Geschichten wurden Dokumente. Zunächst war Schrift ein Werkzeug der Verwaltung. In Mesopotamien entstanden die ersten Zeichen, um Besitz, Tauschgeschäfte, Abgaben festzuhalten und die Azteken benutzten beispielsweise ein Knotensystem für die Dokumentation von Wissen. Doch schnell erkannten Gesellschaften das Potenzial: Wenn Gedanken aufgeschrieben werden konnten, mussten sie nicht mehr von Stimme zu Stimme wandern. Sie konnten überdauern – und sich verbreiten. Das veränderte alles. Wissen wurde vergleichbar. Es konnte kommentiert, widerlegt, weiterentwickelt werden. Mit der Schrift entstand eine neue Form von Denken: analytisch, systematisch, dauerhaft. Doch auch: exklusiv. Denn wer nicht lesen konnte, blieb aussen vor.
Der Buchdruck: Wissen beginnt zu zirkulieren
Viele Jahrhunderte später sorgte eine neue Technologie für eine zweite Revolution: der Buchdruck. Mit Gutenbergs beweglichen Lettern wurden Texte nicht mehr abgeschrieben – sie wurden vervielfältigt. Und damit wurde Wissen beweglich. Die Reformation, die Aufklärung, die Anfänge moderner Wissenschaft – all das wäre ohne den Buchdruck nicht denkbar gewesen. Plötzlich konnten Ideen breite Kreise ziehen, unabhängig von Herkunft oder Ort. Bildung wurde zum Ideal, Lesen zur Kulturtechnik, das Buch zum Statussymbol. Doch noch etwas veränderte sich: die Geschwindigkeit, mit der Wissen entstehen und sich verbreiten konnte. Wer las, konnte denken. Wer dachte, konnte schreiben. Wer schrieb, konnte andere erreichen. Wissen war nicht mehr das, was weitergegeben wurde – sondern das, was entdeckt und diskutiert wurde.
Speicherorte des Wissens – Und was sie über uns verraten**
Wenn wir von Wissen sprechen, denken wir oft an Inhalte. Doch ebenso spannend ist die Frage: Wo liegt dieses Wissen eigentlich?
Seit der Erfindung der Schrift haben Menschen versucht, Wissen physisch zu fixieren. In Tempelbibliotheken, Klosterarchiven und Stadtchroniken wurde gesammelt, was bewahrt werden sollte – meist religiös, politisch oder wirtschaftlich Relevantes.
Diese Orte waren nie nur Lagerräume – sie waren Machtzentren. Wer kontrollierte, was aufbewahrt wurde, bestimmte auch, was als wichtig galt. Die Bibliothek von Alexandria symbolisierte nicht nur Universalität – sie war Ausdruck eines imperialen Wissensanspruchs.
Mit der Moderne kamen neue Orte hinzu: Nationalbibliotheken, Universitätsarchive, Patentämter. Sie gaben Wissen eine Struktur – und eine Norm. In ihren Katalogen spiegelte sich oft eher die Ordnung der Gesellschaft als die der Inhalte.
Heute liegen viele Wissensspeicher in unsichtbaren Rechenzentren – in Clouds, auf Servern, in Indexdatenbanken. Google weiss nicht nur, wo was steht – sondern entscheidet mit, was sichtbar ist. Der Speicherort ist zur Plattform geworden – und diese Plattform formt unser Bild von Relevanz.
Was wir daraus lernen: Jede Form von Wissensspeicherung ist auch Gestaltung. Wer das Archiv baut, schreibt mit an der Geschichte. Und wer Inhalte verschlagwortet, filtert oder „rankt“, bestimmt mit, wie Wissen gefunden – oder vergessen – wird.
Die Moderne: Wissen wird System
Mit der Industrialisierung und dem Aufstieg der Wissenschaften wurde Wissen weiter rationalisiert. Es wurde organisiert, katalogisiert, unterteilt. Die Universität wurde zur Fabrik der Erkenntnis. Unternehmen entwickelten Handbücher, Prozesse, Qualitätsmanagementsysteme. Wissen wurde nicht mehr nur bewahrt oder verbreitet – es wurde produziert. Und wie jede Produktion, brauchte es Standards: Peer Reviews, Definitionen, Fachsprachen. Gleichzeitig wurde Wissen zum Wirtschaftsfaktor: Wer etwas wusste, konnte etwas herstellen, verbessern, verkaufen. Doch mit der Systematisierung kam auch die Fragmentierung. Der eine wusste vom Motor, die andere vom Markt, der Dritte vom Gesetz.
Die digitale Wende: Wissen wird verfügbar
Dann kam das Internet – und mit ihm eine neue Vorstellung von Wissen. Wissen war plötzlich nicht mehr gebunden an Orte oder Körper, an Bücher oder Archive. Es war einfach da – immer, überall, auf Knopfdruck. Diese Verfügbarkeit war befreiend – und überfordernd. Wer sollte all das filtern? Wer sortieren? Wer entscheiden, was stimmt? Algorithmen traten an die Stelle von Bibliothekaren, Likes ersetzten Zitate, Sichtbarkeit wurde wichtiger als Tiefe. Und doch: Das Netz machte Wissen demokratisch. Jeder konnte teilnehmen, lehren, lernen. Blogs, Foren, Wikipedia – sie veränderten das Verhältnis zwischen Sender und Empfänger. Wissen wurde nicht mehr nur vermittelt – es wurde geteilt, verlinkt, erweitert. Und wieder einmal veränderte das Medium die Form des Denkens.
Der Sprung in die Gegenwart: KI als Wissensform?
Heute, nur wenige Jahrzehnte nach der Digitalisierung, stehen wir schon wieder an einem Wendepunkt. Sprachmodelle wie GPT-4, Claude oder Gemini verändern, wie wir mit Wissen umgehen. Sie erzeugen auf Zuruf Texte, Analysen, Ideen. Sie fassen zusammen, beantworten, paraphrasieren. Und dabei tun sie etwas, was lange exklusiv dem Menschen vorbehalten war: Sie wirken klug. Doch sind sie das auch? Was hier entsteht, ist kein Wissen im eigentlichen Sinne – sondern eine Simulation von Wissen. Sprachmodelle berechnen Wahrscheinlichkeiten, keine Bedeutungen. Und dennoch: Sie werden genutzt – in Schulen, Unternehmen, Behörden. Die grosse Herausforderung unserer Zeit ist deshalb nicht die Technik – sondern der Umgang damit. Wir müssen neu definieren, was wir unter Wissen verstehen, wenn jeder Inhalt generierbar geworden ist. Was bedeutet verstehen, wenn Verstehen nicht mehr nötig ist, um einen Text zu produzieren?
Und was bleibt?
Wenn wir auf diesem Rundgang zurückblicken, sehen wir keine lineare Erfolgsgeschichte. Wir sehen eine Reihe von Transformationen – jede mit neuen Möglichkeiten, neuen Fragen, neuen Risiken. Wissen war flüchtig – und wurde dauerhaft. Es war exklusiv – und wurde öffentlich. Es war systematisch – und wurde chaotisch. Es war menschlich – und wird jetzt simuliert. Vielleicht ist die wichtigste Erkenntnis: Wissen ist nicht das, was gespeichert wird. Sondern das, was verstanden, hinterfragt, in Beziehung gesetzt wird. Es lebt nicht im Medium – sondern in der Haltung. Und genau deshalb lohnt sich der Blick zurück. Weil er zeigt, dass jede neue Form von Wissen nicht nur neue Antworten bringt – sondern auch neue Verantwortung.