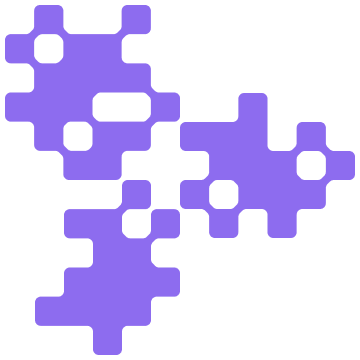ERP-Systeme im Vergleich: So treffen Sie die richtige Wahl für Ihr Unternehmen
Hanna Lorenzer
Sat Jul 12 2025
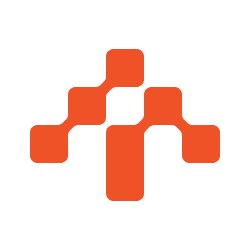
Inhaltsverzeichnis
- Die zunehmende Vielfalt im ERP-Markt: Warum das Thema jetzt aktuell ist
- Was versteht man unter Diversifikationsfaktoren bei ERP-Systemen?
- Cloud, On-Premises oder Hybrid: Wie wichtig ist das Betriebsmodell?
- Der Branchenschwerpunkt als strategischer Vorteil
- Benutzerfreundlichkeit – das oft unterschätzte Differenzierungsmerkmal
- Preisgestaltung und Lizenzmodelle: Von einmalig bis nutzungsabhängig
- Integration und Offenheit: Warum APIs heute Pflicht sind
- Regulatorische Anforderungen und regionale Besonderheiten
Welche Unterschiede gibt es zwischen ERP-Systemen – und wie finden Sie die richtige Lösung für Ihr Unternehmen? Dieser Blog zeigt die wichtigsten Diversifikationsfaktoren und gibt konkrete Entscheidungshilfen.
Die zunehmende Vielfalt im ERP-Markt: Warum das Thema jetzt aktuell ist
Noch vor zehn Jahren bestand der ERP-Markt aus einigen wenigen, dominierenden Anbietern. Heute ist das Angebot so vielfältig wie nie zuvor. Neue technologische Möglichkeiten, veränderte regulatorische Anforderungen und eine stärker differenzierte Nachfrage haben dazu geführt, dass ERP-Systeme sich deutlich voneinander unterscheiden – nicht nur in der Technik, sondern auch in Strategie, Aufbau und Zielgruppe. Gerade mittelständische Unternehmen stehen dadurch vor einer Herausforderung: Wie lässt sich unter den zahlreichen Optionen die passende Lösung identifizieren? Die Zeiten, in denen „ein ERP für alle“ ausreichte, sind vorbei. Stattdessen gewinnen individuelle Auswahlkriterien an Bedeutung. Gartner in MyFactory prognostiziert, dass bis 2025 rund zwei Drittel aller Unternehmen auf modulare und adaptive ERP-Lösungen setzen werden. Der Fokus verlagert sich also vom Standard hin zur Passung – und das macht eine genaue Auseinandersetzung mit den sogenannten Diversifikationsfaktoren unverzichtbar.
Was versteht man unter Diversifikationsfaktoren bei ERP-Systemen?
Der Begriff „Diversifikationsfaktor“ beschreibt jene Merkmale, die ERP-Systeme im Kern voneinander unterscheiden. Laut einer aktuellen Umfrage sind 75 % der ERP-Strategien nicht stark auf die Gesamtgeschäftsstrategie abgestimmt, was zu Verwirrung und mässigen Ergebnissen führt. Deswegen prognostiziert Gartner, dass bis 2027 mehr als 70 % aller ERP-Projekte ihre ursprünglich definierten Business-Ziele nicht vollständig erreichen – oft weil die Systeme nicht flexibel genug sind, um auf veränderte Geschäftsanforderungen zu reagieren. So rücken Flexibilität und Modularität ins Zentrum der Auswahl. Dabei geht es nicht nur um technische Details, sondern um funktionale, strategische und wirtschaftliche Aspekte, die in der Praxis grosse Auswirkungen haben. Für Unternehmen bedeutet das: Ein ERP-System ist kein generisches Werkzeug, sondern eine Lösung, die sich ganz gezielt auf bestimmte Rahmenbedingungen zuschneiden lässt – oder eben auch nicht. Wichtige Diversifikationsfaktoren sind unter anderem die technologische Plattform, der Grad der Individualisierbarkeit, branchenspezifische Ausrichtungen, Integrationsmöglichkeiten in bestehende IT-Landschaften, Lizenz- und Preismodelle sowie die Benutzerfreundlichkeit. Jeder dieser Faktoren kann – abhängig von Geschäftsmodell, Unternehmensgrösse und Digitalisierungsgrad – zu einem entscheidenden Auswahlkriterium werden.
Cloud, On-Premises oder Hybrid: Wie wichtig ist das Betriebsmodell?
Einer der grundlegenden Unterschiede zwischen ERP-Systemen liegt in der Frage, wo und wie das System betrieben wird. Während klassische On-Premises-Lösungen noch immer in bestimmten Branchen wie dem Finanzwesen oder der Industrie gefragt sind, setzen viele Unternehmen heute auf Cloud-Modelle. Der Hauptgrund dafür liegt in der Flexibilität: Cloud-basierte ERP-Systeme ermöglichen einen schnelleren Rollout, geringere Einstiegskosten und eine einfachere Skalierung. Zudem profitieren Unternehmen von automatischen Updates und kontinuierlicher Weiterentwicklung. Laut NetSuite wächst der Markt für Cloud-ERP von 72,2 Mrd $ (2023) auf 130,5 Mrd $ bis 2028 – ein starkes Signal für die gravierende Verschiebung hin zu flexibleren, skalierbaren ERP-Modellen. Dennoch ist die Cloud nicht immer die beste Lösung. Unternehmen mit strengen Datenschutzanforderungen oder speziellen Systemanforderungen entscheiden sich häufig für hybride Modelle, bei denen sensible Daten im eigenen Rechenzentrum bleiben, während andere Funktionen über die Cloud bereitgestellt werden. Die Wahl des Betriebsmodells sollte deshalb stets im Einklang mit der IT-Strategie und den Compliance-Vorgaben erfolgen.
Der Branchenschwerpunkt als strategischer Vorteil
Ein entscheidender Aspekt bei der Auswahl eines ERP-Systems ist dessen Branchentauglichkeit. Denn die Anforderungen eines produzierenden Unternehmens unterscheiden sich grundlegend von denen eines Dienstleisters oder eines Handelsunternehmens. Gute ERP-Anbieter reagieren auf diese Realität mit branchenspezifischen Templates, Modulen und Konfigurationen. So lassen sich Prozesse abbilden, ohne aufwändige Individualentwicklungen durchführen zu müssen. Gerade im Mittelstand zeigt sich, wie wertvoll diese Spezialisierungen sind. Ein ERP-System, das für den Maschinenbau entwickelt wurde, enthält beispielsweise standardisierte Module für Produktionsplanung, Stücklistenmanagement und Instandhaltung – Funktionen, die in einer Agentur kaum benötigt werden. Die Branchenausrichtung reduziert nicht nur Implementierungsaufwand, sondern erhöht auch die Systemakzeptanz bei den Mitarbeitenden.
Benutzerfreundlichkeit – das oft unterschätzte Differenzierungsmerkmal
Laut einer Publikation von SoftwareAdvice geben über 90 % der ERP-Nutzer an, dass die Benutzerfreundlichkeit entscheidend für ihre Akzeptanz und Produktivität ist Technische Leistungsfähigkeit allein reicht nicht aus. Ein ERP-System kann noch so mächtig sein – wenn es in der täglichen Anwendung kompliziert und unübersichtlich ist, wird es nicht produktiv genutzt. In der Praxis bedeutet das: Benutzerfreundlichkeit ist kein „Nice-to-have“, sondern ein erfolgskritischer Faktor. Moderne ERP-Lösungen setzen auf eine klare, intuitive Nutzeroberfläche, rollenbasierte Dashboards und mobile Zugänglichkeit. Die Erfahrung zeigt, dass ein positives Nutzungserlebnis nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch die Akzeptanz im Unternehmen deutlich erhöht. Besonders im Kontext von Self-Service-Funktionen, etwa für das Controlling oder das Personalmanagement, ist eine durchdachte UX heute unerlässlich.
Preisgestaltung und Lizenzmodelle: Von einmalig bis nutzungsabhängig
Die Preisgestaltung gehört zu den sichtbarsten Diversifikationsfaktoren. Während manche Anbieter auf klassische Einmallizenz-Modelle setzen, die durch Wartungsgebühren ergänzt werden, gehen moderne Anbieter verstärkt zu Abonnement- oder nutzungsabhängigen Modellen über. Diese bieten den Vorteil, dass die Kosten stärker an der tatsächlichen Nutzung orientiert sind und sich besser planen lassen. Zudem gibt es Unterschiede in der Art der Lizenzierung – etwa zwischen Named-User-, Concurrent-User- oder modulbasierter Abrechnung. Unternehmen sollten hier besonders auf die Skalierbarkeit und Transparenz achten. Ein scheinbar günstiges Basismodell kann sich bei wachsender Nutzerzahl schnell zu einem Kostenfaktor entwickeln, wenn die Lizenzstruktur nicht mitwächst. Ein Report der Panorama Consulting Group zeigt, dass die Aufsetzung und Durchführung eines ERP Projekts bis zu $625'000 kostet; ein Projekt dessen Kosten gut geschätzt und eingehalten werden können.
Welche Lizenz passt zu Ihrem Unternehmen?
ERP-Anbieter arbeiten mit sehr unterschiedlichen Lizenzmodellen – und jedes bringt eigene Stärken und Schwächen mit sich. Während klassische Einmallizenzen langfristige Stabilität bieten, punkten moderne Abo-Modelle mit Flexibilität und planbaren monatlichen Kosten. Besonders wachstumsorientierte Unternehmen sollten auch auf nutzungsabhängige Modelle achten, die dynamisch skalieren. Die folgende Infografik zeigt die wichtigsten Lizenzarten im Überblick – mit typischen Vor- und Nachteilen sowie einem Schnellvergleich für Ihre Auswahlentscheidung:
Integration und Offenheit: Warum APIs heute Pflicht sind
Kein ERP-System steht heute für sich allein. Die Fähigkeit, sich nahtlos mit anderen Systemen zu verbinden – seien es CRM-Tools, Dokumentenmanagementsysteme oder Business-Intelligence-Plattformen – ist entscheidend für die Prozessdurchgängigkeit. Moderne ERP-Systeme überzeugen hier durch offene Schnittstellen, standardisierte APIs und eine modulare Architektur. Je offener ein ERP-System aufgebaut ist, desto einfacher lassen sich bestehende Workflows erhalten und neue Anwendungen integrieren. Das reduziert nicht nur Projektaufwand, sondern erhöht auch die Zukunftsfähigkeit des Systems. Unternehmen, die bereits heute auf Interoperabilität achten, sichern sich langfristige Flexibilität.
Regulatorische Anforderungen und regionale Besonderheiten
Ein oft übersehener, aber hoch relevanter Diversifikationsfaktor ist die Erfüllung gesetzlicher und branchenspezifischer Anforderungen. In der Schweiz ist beispielsweise die Einhaltung der GeBüV (Geschäftsbücherverordnung) ein zentraler Aspekt, in Deutschland gelten die GoBD, in der EU wiederum die DSGVO. Hinzu kommen branchenspezifische Zertifizierungen wie ISO 27001, TISAX oder GDP (für Pharmaunternehmen). Ein ERP-System muss diese Anforderungen entweder nativ erfüllen oder über Erweiterungen anpassbar sein. Wichtig ist dabei nicht nur die technische Umsetzung, sondern auch die Auditierbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Prozesse – insbesondere im Hinblick auf Revisionssicherheit und Datenhaltung.
Die Suche nach einem ERP-System sollte nicht mit der Frage beginnen, welches System „am besten“ ist – sondern welches „am besten passt“. Die Diversifikationsfaktoren liefern dafür den entscheidenden Kompass. Wer weiss, welche Kriterien für das eigene Unternehmen wichtig sind, kann systematisch vergleichen, bewerten und entscheiden. Eine strukturierte Vorgehensweise – etwa über ein ERP-Scoring-Modell – erleichtert diesen Auswahlprozess erheblich. Dabei werden die wichtigsten Faktoren gewichtet und mit den Anforderungen des Unternehmens abgeglichen. So entsteht ein fundiertes Bild, das Entscheidungsträgern Orientierung gibt.